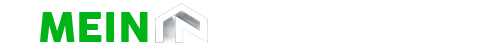Gewölbekeller sind ein beeindruckendes Zeugnis traditioneller Baukunst. Viele dieser unterirdischen Räume stammen aus vergangenen Jahrhunderten und wurden ursprünglich für die Lagerung von Wein, Lebensmitteln oder Vorräten gebaut. Ihr besonderes Klima, die charakteristische Formgebung und die massiven Naturstein- oder Ziegelkonstruktionen verleihen ihnen einen einzigartigen Charme, doch gerade ihr Alter bringt Herausforderungen mit sich.
Gewölbekeller fachgerecht sanieren: Darauf sollte man achten
Feuchtigkeit, bröckelndes Mauerwerk, Salzausblühungen oder mangelhafte Belüftung machen eine Nutzung oft unmöglich. Wer einen solchen Keller nicht nur erhalten, sondern auch sinnvoll nutzen möchte, kommt um eine fachgerechte Sanierung nicht herum. Dabei geht es nicht allein um Schönheitsreparaturen, sondern eine solide Sanierung muss auch die Ursachen beheben, die Substanz erhalten und den Raum bauphysikalisch in einen dauerhaft nutzbaren Zustand versetzen. Dieser Ratgeber bietet eine strukturierte Einführung in das Thema und gibt praxisnahe Hinweise zu Planung, Instandsetzung, Abdichtung und Nutzung von Gewölbekellern.
Ursachen für Feuchtigkeit: Altlasten im Mauerwerk verstehen
In vielen historischen Gebäuden fehlen grundlegende bauliche Maßnahmen, die heute selbstverständlich sind. Eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist oftmals nicht vorhanden. Eine außen liegende Abdichtung gegen seitlich eindringendes Erdreich-Wasser ist in den meisten Fällen ebenfalls nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen. Stattdessen wurden diese Keller im direkten Kontakt mit dem Erdreich errichtet und überdauerten so Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte.

A.von Dueren/shutterstock.com
Feuchtigkeit dringt auf mehreren Wegen ein: über das Fundament, durch kapillar wirkende Fugen oder durch direkte Wasserbelastung bei Starkregen und hohem Grundwasserstand. Ein weiterer Faktor ist Kondenswasser. Warme Raumluft trifft auf die kalten Kellerwände und Feuchtigkeit schlägt sich nieder. In nicht belüfteten Räumen steigt die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich an und die Folge sind Salzausblühungen, Schimmel und eine allmähliche Zersetzung der Bausubstanz.
Auch bauliche Veränderungen am Haus oder Grundstück können die Feuchtelast erhöhen. Beispielsweise können neu angelegte Terrassen, Drainagen oder versiegelte Oberflächen den Wasserlauf im Boden verändern. Ohne eine umfassende Analyse lässt sich die Hauptursache oft nur schwer benennen, und eine systematische Untersuchung ist daher unerlässlich, bevor entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.
Vor der Sanierung: Zustand erfassen und Nutzung definieren
Bevor Werkzeuge zum Einsatz kommen, ist eine gründliche Bestandsaufnahme notwendig. Jeder Gewölbekeller ist anders in seiner Bauweise, seinem Alter und seiner Bausubstanz. Umso wichtiger ist es daher, sich ein klares Bild vom Zustand des Mauerwerks, des Gewölbes und des Bodens zu machen. Sichtbare Schäden wie etwa Risse, Ausblühungen oder Abplatzungen sind nur ein erster Hinweis.
Feuchtemessungen liefern belastbare Daten. Hierfür kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, wie beispielsweise kapazitive oder resistive Sensoren, Probenentnahmen oder Langzeitmessungen. Auch thermografische Aufnahmen können verdeckte Schwachstellen sichtbar machen. Bei Rissen oder Setzungen sollte ein Baufachmann hinzugezogen werden, um statische Risiken auszuschließen.

baxys/shutterstock.com
Parallel zur Substanzanalyse sollte bereits die spätere Nutzung definiert werden. Wird der Keller weiterhin als Lagerraum dienen oder soll er künftig als Weinkeller, Hobbyraum oder sogar Wohnraum genutzt werden? Je nach Zielsetzung ändern sich die Anforderungen an Dämmung, Lüftung, Bodenaufbau und Ausstattung. Ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept berücksichtigt dabei alle diese Aspekte und verhindert spätere Nacharbeiten.
Mauerwerk reinigen, instand setzen und vorbereiten
Die eigentliche Sanierung beginnt mit der Freilegung und Reinigung des Bestandsmauerwerks. Alte Putzschichten, Anstriche oder lose Fugen müssen entfernt werden und dies besonders behutsam und ohne die Substanz dabei zu beschädigen. Besonders bei Natursteinmauerwerk empfiehlt sich ein schonendes Verfahren, etwa mit weichen Bürsten oder Niederdruck-Strahltechniken. Ziel ist es, den Untergrund so weit freizulegen, dass mögliche Schäden sichtbar werden.
Anschließend werden beschädigte Steine ersetzt, Risse ausgearbeitet und fachgerecht verfüllt. Dabei ist die Wahl des Mörtels sehr wichtig, denn gerade historische Mauerwerke reagieren empfindlich auf zu harte Materialien. Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel gelten als geeignet, weil sie diffusionsoffen und salzbeständig sind. Zementhaltige Produkte sind in der Regel ungeeignet, denn sie sperren Feuchtigkeit ein und verstärken dadurch langfristig die Schädigung.

rigsbyphoto/shutterstock.com
Nach der Reparatur folgt das Neuverfugen oder sofern erforderlich, ein vollflächiger Neuverputz. Verwendet werden sollten spezielle Sanierputze, die auf salzbelastetes Mauerwerk abgestimmt sind. Diese Systeme bestehen oft aus mehreren Lagen, die unterschiedlich aufbauen und zusammen eine funktionale Pufferzone gegen Feuchtigkeit bilden. Wichtig: Alle Materialien müssen aufeinander abgestimmt und fachgerecht verarbeitet werden, denn sonst drohen erneut Schäden.
Abdichtung und Schutz: Den Keller vor neuer Feuchte bewahren
Ein funktionierendes Abdichtungskonzept ist das Rückgrat jeder Gewölbekeller-Sanierung. In vielen Fällen lässt sich eine äußere Abdichtung, etwa durch Aufgraben der Außenwände, nicht oder nur mit großem Aufwand realisieren. Umso wichtiger ist die Innenabdichtung, die gezielt auf die besonderen Anforderungen eines Altbaus zugeschnitten sein muss. Mineralische Dichtungsschlämmen bieten sich hier als erster Schutz an. Sie werden in mehreren Schichten direkt auf das Mauerwerk aufgetragen und wirken wasserabweisend, ohne die Diffusionsfähigkeit vollständig zu unterbinden. Ergänzend dazu kann ein kapillar-aktiver Sanierputz aufgebracht werden, der als zweite Schutzschicht funktioniert.

Kuchina/shutterstock.com
Gegen aufsteigende Feuchtigkeit helfen horizontale Sperren. Diese lassen sich entweder mechanisch (z. B. durch Edelstahlplatten) oder chemisch (mittels Injektionsverfahren) ins Mauerwerk einbringen. Welche Methode sich am besten eignet, hängt vom Mauerquerschnitt, der Durchfeuchtung und der Bauweise ab. Hier sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
Auch der Boden darf nicht vernachlässigt werden. Ein funktionaler Aufbau besteht aus einer kapillar-brechenden Schicht, eventuell einer Abdichtungsbahn und einem Belag, der diffusionsoffen bleibt. Beliebt sind Tonziegel, Natursteinplatten oder speziell behandelte Betonböden. Eine nachträgliche Unterlüftung, wie etwa durch Noppenbahnen oder Drainagematten, kann die Trocknung zusätzlich fördern.
Lüftung, Nachnutzung und langfristiger Erhalt
Ist der Keller saniert, beginnt die Phase der klimatischen Stabilisierung. Eine kontrollierte Belüftung ist dabei unerlässlich. Klassisches Dauerlüften ist kontraproduktiv, denn es führt in warmen Jahreszeiten häufig zu Tauwasserbildung an den kalten Wänden. Stattdessen empfiehlt sich gezieltes Stoßlüften, am besten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, wenn die Außentemperatur niedriger ist als im Keller.
Für konstant gute Bedingungen sorgt eine automatische Lüftung mit Taupunktsteuerung. Diese Systeme messen kontinuierlich Temperatur und Feuchtigkeit und öffnen die Fenster oder Lüftungsklappen nur dann, wenn keine Kondensatbildung zu erwarten ist. Das schützt nicht nur das Mauerwerk, sondern auch mögliche Einbauten.

magpie25/shutterstock.com
Die Nutzungsmöglichkeiten eines sanierten Gewölbekellers sind vielfältig und reichen vom stilvollen Weinkeller über Archivräume bis hin zu kleinen Ateliers oder Ausstellungsräumen. Wichtig ist, dass die Ausstattung, Möblierung und Technik auf die Bedingungen eines Altbaus abgestimmt sind. Möbel sollten keine Luftzirkulation verhindern, Böden diffusionsoffen bleiben und elektrische Installationen feuchte-resistent sein. Auch nach der Sanierung ist eine gewisse Pflege notwendig. Regelmäßige Sichtkontrollen, Reinigungen und gegebenenfalls Nachbesserungen verlängern zudem die Lebensdauer erheblich. Kleine Schäden, wie Risse oder Ablösungen, sollten frühzeitig behoben werden, um kostspielige Sanierungszyklen zu vermeiden.
Fazit
Ein Gewölbekeller ist mehr als ein ungenutzter Raum unter der Erde, er ist Teil der Geschichte eines Hauses, das oftmals handwerklich meisterhaft gebaut wurde und eine einzigartige Atmosphäre aufweist. Eine Sanierung verlangt Respekt vor der Bausubstanz, ein tiefes Verständnis der Bauphysik und handwerkliche Präzision. Wird er aber fachgerecht instand gesetzt, so entstehen wertvolle Räume, die sich dauerhaft nutzen lassen und zudem sehr stilvoll sind.
Die hier beschriebenen Schritte bilden eine solide Grundlage, ersetzen jedoch nicht die individuelle Planung und Beratung. Wer seine Gewölbedecke erhalten und den Raum sinnvoll nutzen möchte, sollte sich Zeit nehmen, die Ursachen genau analysieren und mit Weitsicht sanieren. So bleibt das, was über Generationen bestand, auch für die Zukunft erhalten.