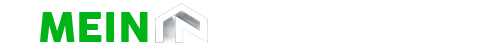Der eigene Garten ist mehr als nur Erholungsfläche. Er wird zunehmend zum funktionalen Bestandteil moderner Energieversorgung. Das geht vom Flüssiggastank bis zur Solaranlage, vom Speicherakku bis zur Gartensteckdose.
Angesichts steigender Energiepreise, Klimaziele und technischer Innovationen denken immer mehr Hausbesitzer darüber nach, wie sie ihr Grundstück effizienter nutzen können. Nämlich nicht nur für Pflanzen, sondern auch für nachhaltige Energie. Dieser Beitrag soll zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, den Garten als Energiequelle zu begreifen,von klassischen Lösungen bis zu neuen Technologien.
1. Wann sich ein eigener Flüssigtank lohnt
Einen Flüssiggastank kaufen ist für viele Hausbesitzer eine strategische Entscheidung, denn er bietet Versorgungssicherheit, planbare Kosten und hohe Energieeffizienz. Wenn man in ländlichen Regionen wohnt, kann dieser eine zuverlässige Lösung darstellen, da er unabhängig vom Gasnetz bleibt. Moderne Flüssiggasheizungen arbeiten mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 Prozent und bieten zugleich ein hohes Maß an Unabhängigkeit, da kein Anschluss an ein öffentliches Gasnetz erforderlich ist.
Die Tanks lassen sich flexibel ober- oder unterirdisch installieren und überzeugen durch eine saubere Verbrennung mit rund 15 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu Heizöl. Darüber hinaus sind sie zukunftsfähig, da Flüssiggas zunehmend auch als Bio-LPG aus erneuerbaren Quellen verfügbar ist. Für ein autarkes Leben kann Flüssiggas in Kombination mit Solarstrom oder Wärmepumpen genutzt werden, um ein flexibles Energiesystem zu schaffen. Bei dem Kauf eines Flüssiggastanks kann man mit Kosten zwischen 2.500 und 3.500 Euro rechnen.
2. Solarenergie im Garten – mehr als nur Strom vom Dach
Die Nutzung von Photovoltaik beschränkt sich heutzutage nicht mehr ausschließlich auf Hausdächer. In der heutigen Zeit setzen Gartenbesitzer auf die Nutzung von Solartechnik, sei es auf Gartenhäusern, Carports oder mobilen Modulen. Die Nutzung von Solarenergie im Garten eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie ist in der Lage, Gartenbeleuchtungen, Teichpumpen, Bewässerungssysteme sowie elektrische Geräte mit sauberem Strom zu versorgen. Besonders beliebt sind kompakte Mini-PV-Anlagen, sogenannte Balkonkraftwerke oder kleine Installationen bis 800 Watt, die auch für Einsteiger geeignet sind.
Der Nutzen ist vielversprechend, denn Hausbesitzer können ihre Stromkosten senken, einen aktiven Beitrag zur CO2-Reduktion leisten und bislang unerschlossene Flächen effizienter nutzen. Darüber hinaus werden zahlreiche dieser Anlagen regional gefördert. Gemäß einer Studie des Fraunhofer ISE besteht nämlich die Möglichkeit, durch kleine Solaranlagen auf Nebengebäuden bis zu zehn Prozent des privaten Strombedarfs zu decken. Dies ist ein beachtlicher Schritt in Richtung Eigenversorgung und Nachhaltigkeit.
3. Wärmepumpen im Außenbereich – Heizen mit Umweltenergie
Wärmepumpen nutzen die natürliche Energie aus Luft, Wasser oder Erde und machen sie für die Wärmeversorgung eines Hauses nutzbar. Der Garten spielt dabei eine entscheidende Rolle, insbesondere bei Erd- und Luftwärmepumpen, die direkt mit ihrer Umgebung interagieren. Luftwärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme, selbst bei niedrigen Temperaturen, und wandeln sie in Heizenergie um. Erdwärmepumpen hingegen nutzen Flach- oder Tiefensonden im Boden, um konstante Temperaturen im Erdreich zu erschließen. Bei Vorhandensein von Grundwasser oder einem Brunnen kann eine Wasser-Wärmepumpe eingesetzt werden, die die gespeicherte Energie des Wassers nutzt.
Der Vorteil dieser Technik liegt in ihrer Effizienz und Nachhaltigkeit: Wärmepumpen arbeiten unabhängig von fossilen Brennstoffen, sind mit Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen kombinierbar und zeichnen sich durch niedrige Betriebskosten aus. Darüber hinaus werden sie durch staatliche Förderprogramme, wie sie beispielsweise durch das BAFA oder die KfW angeboten werden, finanziell unterstützt. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, bestimmte Voraussetzungen zu berücksichtigen, da für die Installation von Erdsondenanlagen eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich ist und Luft-Wärmepumpen mit ausreichendem Abstand zu Nachbargrundstücken installiert werden sollten, um Lärmemissionen zu vermeiden.
Die Technik fügt sich auf diese Weise nahtlos in das Gesamtkonzept des Gartens ein und stellt eine umweltfreundliche sowie zukunftssichere Lösung für die Beheizung dar.In Verbindung mit Flüssiggas als Backup-System kann die Wärmepumpe auch während Spitzenlastzeiten effizient betrieben werden. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP e.V.) informiert zudem weiter über Einsatzmöglichkeiten und Anforderungen welche es bei modernen Wärmesystempumpen braucht.