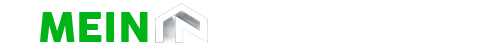Kaum ein Raum wird so oft unterschätzt wie die Küche. Dabei ist es der Ort, an dem die meisten Gerüche entstehen, die sich in Polstern, Vorhängen und Kleidung festsetzen. Eine einzige Stunde Braten oder Kochen genügt, und die Luft bleibt noch Tage später schwer im Raum hängen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes gehören Fett- und Geruchspartikel zu den häufigsten Quellen für schlechte Innenraumluft. Genau hier setzt die richtige Planung an. Lüftungssysteme entscheiden darüber, ob wir entspannt genießen oder in stickiger Luft ausharren müssen.
Alte Küchenlüfter sind kein Garant für gute Luft
Viele Menschen vertrauen noch immer auf die kleinen Dunstabzugshauben, die über Jahrzehnte Standard waren. Doch moderne Kochgewohnheiten stellen ganz andere Anforderungen. Während früher eher selten mit hohen Temperaturen gekocht wurde, sind heute kräftiges Anbraten, scharfes Würzen und internationale Rezepte alltäglich. Wer regelmäßig Fleisch, Fisch oder Gemüse in heißen Bratpfannen zubereitet, kennt die typischen Ablagerungen, die selbst nach gründlichem Putzen bleiben. Diese Rückstände setzen sich nicht nur in Oberflächen fest, sondern auch in der Raumluft, die wir einatmen.
Die Folge ist eine ständige Belastung, die langfristig sogar die Bausubstanz angreifen kann. Wissenschaftler der Technischen Universität Dresden haben in einer Untersuchung bestätigt, dass Fettdämpfe sich tief in Tapetenfasern und Holzoberflächen einlagern. Damit entsteht ein Problem, das nicht nur hygienisch, sondern auch bauphysikalisch relevant ist. Alte Hauben mit Umluftfiltern stoßen hier schnell an ihre Grenzen, weil sie kaum Partikel aus der Luft entfernen können. Sie geben bestenfalls ein Gefühl von Sicherheit, ohne den Kern des Problems zu lösen.
Frische Luft hängt von der Technik ab
Ein gut durchdachtes Lüftungssystem ist weit mehr als nur ein elektrisches Gerät. Es ist ein Zusammenspiel aus Filtertechnik, Motorleistung und intelligenter Luftführung. Entscheidend ist, dass nicht nur Gerüche, sondern auch Feuchtigkeit zuverlässig abgeführt werden. Denn Wasserdampf, der beim Kochen entsteht, begünstigt Schimmelbildung an Wänden und Decken. Diese Gefahr wird häufig unterschätzt, obwohl Studien des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik zeigen, dass bereits wenige Prozentpunkte mehr Luftfeuchtigkeit langfristig Schäden verursachen können.
Zahlreiche ältere Gebäude sind besonders anfällig, weil sie nicht über eine mechanische Lüftung verfügen. Bewohner öffnen in der Regel einfach das Fenster. Doch diese Methode reicht nur bedingt, vor allem in dicht bebauten Wohngebieten oder bei schlechter Außenluft. Feinstaub und Pollen gelangen zusätzlich ins Haus und verschärfen die Situation. Eine effektive Filterung wird so zur Grundvoraussetzung für ein gesundes Raumklima.
Planung beginnt bei der Raumarchitektur
Eine Küche lässt sich nicht losgelöst vom restlichen Haus betrachten. Die Art der Lüftung hängt eng mit der Architektur zusammen. Offene Wohnküchen, die direkt ins Wohnzimmer übergehen, stellen ganz andere Herausforderungen als abgeschlossene Räume. Strömt der Dunst ungehindert ins Wohnzimmer, werden Polstermöbel schnell zu Geruchsspeichern. Selbst hochwertige Textilien lassen sich nur schwer wieder neutralisieren. Experten für Innenarchitektur empfehlen deshalb, die Luftwege gezielt zu lenken, damit Gerüche nicht erst ins Wohnzimmer entweichen können.
Hier spielt auch die Größe des Raumes eine wichtige Rolle. Je größer die Küche, desto leistungsstärker muss die Anlage ausgelegt sein. Eine einfache Faustregel besagt: Das gesamte Luftvolumen sollte in einer Stunde sechsmal vollständig ausgetauscht werden. Diese Vorgabe findet sich in Empfehlungen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie.